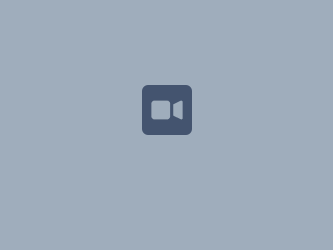Das vorliegende didaktische Konzept umfasst den Einsatz der inklusiven Methode der Differenzierung zum Thema „Fake News“. Im Rahmen der Intervention soll ein komplexer Sachtext anhand von drei Differenzierungsmaßnahmen, die mit drei digitalen Geräten von der Lehrperson erstellt wurden (ChatGPT, The Simple Show und ein Podcast), einen differenzierten Zugang zum Text ermöglichen.
Die Intervention richtet sich insbesondere an heterogene Klassenzusammensetzungen mit Schüler:innen unterschiedlicher Sprach- und Leistungsniveaus. Es besteht zudem die Notwendigkeit für Lehrpersonen, sich mit aktuellen digitalen Tools und inklusiven Methoden auseinanderzusetzen, um Überlegungen zur effektiven Integration in den Unterricht zu ermöglichen. Im Allgemeinen können diese Differenzierungsmaßnahmen herangezogen werden, um komplexe und längere Texteinheiten zugänglicher zu mac
Projektbeschreibung
Das Projekt strebt den gezielten Einsatz digitaler Tools (ChatGPT, Podcast, SimpleShow, Zeoob etc.) an, um einen differenzierten Zugang zu komplexen Sachtexten zum Thema „Fake News“ zu ermöglichen. Ziel ist es, Schüler:innen durch individuell angepasste Methoden das Verstehen, Reflektieren und Produzieren von Inhalten zu ermöglichen – unabhängig von bzw. angepasst an das sprachliche oder kognitive Ausgangsniveau der Lernenden. Die Verbindung aus kritischer Medienkompetenz, Inklusion und digitaler Bildung stellt dabei den innovationsorientierten Kern des Projekts dar.
Was kann damit vermittelt werden?
Das Projekt vermittelt Kompetenzen im Bereich Medienbildung, Demokratiepädagogik, kritisches Denken und Sprache. Schüler:innen lernen, wie Fake News aufgebaut sind, woran sie sie erkennen können und welche manipulativen Wirkmechanismen dahinterstecken. Gleichzeitig entwickeln sie produktive Kompetenzen, indem sie selbst Inhalte in verschiedenen medialen Formaten erstellen – z. B. Podcasts oder Comics. Der demokratiebildende Anspruch (Reflexion über gesellschaftliche Vorurteile und Manipulation) ist eng mit der Medienkritik verknüpft.
In welchem Setting kann es eingesetzt werden?
Eingesetzt werden kann das Projekt in der 9. Schulstufe im Unterrichtsgegenstand Deutsch, Geschichte und Politische Bildung oder in fächerübergreifenden Projekttagen. Es eignet sich sowohl für Regelklassen als auch für inklusive Klassen mit heterogenen Lernvoraussetzungen. Besonders geeignet ist das Projekt für städtische Schulen mit hoher Diversität in Bezug auf Sprachstand und Medienerfahrungen.
Welche Kompetenzen werden angesprochen?
- Fachkompetenzen: Analyse von Texten, Quellenkritik, Erkennen und Produzieren von Fake News
- Digitale Kompetenzen: Nutzung digitaler Werkzeuge zur Inhaltserschließung und Produktion
- Soziale und personale Kompetenzen: Reflexion, Perspektivenübernahme, Teamarbeit
- Inklusive Kompetenzen: Berücksichtigung unterschiedlicher Lernzugänge (visuell, auditiv, sprachlich)
Benötigte Ressourcen auf einen Blick:
Technische Ressourcen:
- Laptop/iPad mit Internetverbindung (pro Schüler:in eines)
- Kopfhörer
- Zugang zu Webseiten (Vocaroo, ChatGPT, SimpleShow)
Zeitliche Ressourcen:
- Einarbeitung für Lehrpersonen: ca. 1-2 Stunden
- Einsatz im Unterricht: 2-3 Unterrichtseinheiten
didaktische Voraussetzungen:
- Offenheit für Nutzung neuer Tools im Unterricht
- Grundverständnis für digitale Tools und dem Umgang mit einem Laptop/ einer KI
- Grundverständnis diverser Lerntypen / Sprachniveaus
- Bereitschaft zur Nutzung technologiegestützter Methoden
Zielgruppe:
- Hauptzielgruppe:
- Fokus: Lernende mit unterschiedlichen Lerntypen (auditiv, visuell,...)
- Einsatz: fächerübergreifend im Regelunterricht
Vorwissen:
- Lehrkräfte: Basiswissen zur Erstellung von Prompts erforderlich
- Schüler*innen: allgemeine digitale Kompetenzen