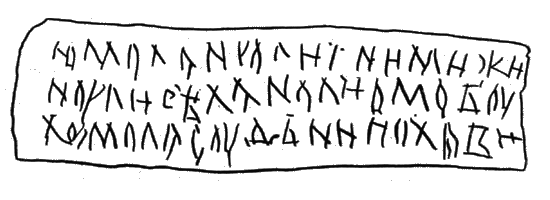DIE KARELIER
Inhaltsverzeichnis
Geschichte
Die ältesten Funde karelischer Siedlungen lassen sich ins 8. Jtsd. v.C. datieren, ab dem 6. Jtsd. v.C. wurden diese frühen Wohngebiete wechselnd von Eroberern aus dem Süden und dem Osten okkupiert und unterlagen nunmehr auch wechselnden kulturellen Einflüssen, die sich teilweise bis heute in der Kultur des Volks gehalten haben.
Im ersten Jtsd. n.C. lebten die karelischen Volksverbände südlich von ihrer späteren Heimat in der Region um die Seen Onega und Ladoga, bis sie im 12. Jhdt. entlang der Nördlichen Dwina gen Norden zogen und vom Weißen Meer bis ins heutige Finnisch-Karelien niederließen, wobei sie die Siedlungsgebiete der heute in Nordeuropa beheimateten saamischen Stämme nach Westen und Osten verschoben und erstmals mit den Wepsen in eine intensive Kontaktsituation traten.
Der nördliche, am Weißen Meer gelegene Teil des heutigen Gebiets der karelischen Republik, das bereits seit dem ersten Jhdt. n.C. von ostslawischen Stämmen bevölkert wurde, findet erstmals in skandinavischen Sagen aus dem 8. Jhdt. n.C. Erwähnung, die ebenfalls von einem Volk namens ,Bjarmanen‘ erzählen, einem reichen Volk, das vor Allem für die herausragende Qualität seiner Pelze bekannt ist.
Der südliche, karelische Landsteil gehörte zwischen dem 9. und dem 12. Jhdt. zu den Besitzungen der Kiewer Rus sowie später zu Nowgorod. Die Karelier selbst werden erstmals, gemeinsam mit benachbarten Ostseefinnen, unter dem Begriff ,Chuden‘ in einer russischen Chronik aus dem mittleren 12. Jhdt. genannt. Eine eigene karelische Identität besteht jedoch bereits seit dem 11. Jhdt., als sie im Verbund mit anderen ostseefinnischen Stämmen wichtige Handelswege der Wikinger annektierten.
Zur selben Zeit dehnte sich das karelische Gebiet, etwa durch Inbesitznahme schwedischer Siedlungen, im Westen weiter aus.
Im 11. und 12. Jhdt. wurde die Missionsaktivität von Seiten der orthodoxen Kirche Nowgorods merkbar stärker, unter Prinz Jaroslav wurden die Karelier schließlich gezwungen, den orthodoxen Glauben anzunehmen.
Ab dem 13. Jhdt. begann Schweden sich vermehrt für seine östlich angrenzenden Gebiete zu interessieren und übernahm in einem Kreuzzug erst seine neue Provinz Finnland, im Anschluss kam es zwischen Nowgorod und Schweden zu heftigen Auseinandersetzungen um die karelischen Territorien, der schwedische Erfolg beschränkte sich jedoch hauptsächlich auf die Küstenlinie um den Finnischen Meerbusen.
Nach einer misslungenen Revolte durch die Karelier annektierte Nowgorod das Gebiet schließlich um 1278.
Nach dreißig Jahre andauernder Kämpfen, in denen die Schweden auch die Festung Wyborg gründeten und nahezu ganz Karelien verwüstet wurde, wurde das Gebiet 1323 im Friedensabkommen von Pähkinäsaari, welches über 250 Jahre lang galt, schließlich in zwei Teile getrennt, das schwedische West- und das Nowgorodsche Ostkarelien, welches noch immer einen Großteil der alten Gebiete umfasste.
Die neue Grenze teilte auch die karelische Kultursphäre und setzte sie seither den unterschiedlichen Einflüssen des Ostens und Westens aus, wobei die Sprache im Ostteil und generell nur von den Bevölkerungsgruppen verwendet wurde, die östlich des Ladogasees siedelten, während die restlichen Stämme eine finnische dialektale Varietät gebrauchte.
Der westliche Teil unter Schwedens Herrschaft entwickelte sich deutlich schneller als das nunmehr russische Karelien, die Schweden begannen ebenfalls die von den Friedensverhandlungen nicht berücksichtigten Weißmeerterritorien im Norden zu besiedeln.
Erneute Grenzkämpfen zwischen den finnischen Savo-Stämmen und den Kareliern führten zum schwedisch-russischen Krieg von 1555-1557, welcher jedoch ohne Resultate endete.
Als es zwischen Schweden und Russland erneut zu Auseinandersetzungen, dem Livischen Krieg kam, der die Gebietsansprüche im Baltikum klären sollte, wurde auch Karelien wieder zum Kriegsschauplatz. Im 1595 folgenden Friedensabkommen von Täyssinä (Tavzinsk) sicherte sich Schweden alle finnischsprachigen Gebiete.
Nach einer kurzen Friedensperiode und erneuten Kämpfen, die 1617 im Frieden von Stolbowo resultierten, befanden sich die Region um den Ladogasee, beide Karelien sowie Ingermanland in schwedischer Besitzung.
Durch die folgende, aggressive schwedische Innenpolitik, die neben drastisch erhöhten Steuern auch die Bekehrung zum lutherischen Christentum durchsetzte, sahen sich zwischen 30.50.000 Personen gezwungen, ihre alte Heimat aufzugeben und zurück in russische Territorien zu flüchten. Etwa die Hälfte der Bevölkerung Kareliens siedelte sich neu zwischen Onega und Ladogasee sowie in der Provinz Tver an, woraus die Gründung Tver-Kareliens resultierte.
Ab dem 18. Jhdt. verlor Schweden zunehmend seine Stellung als Weltmacht und musste große Gebietsverluste hinnehmen, sowohl Altfinnland, das heute ostfinnische Gebiet um die Städte Savonlinna, Hamina und Lappeenranta sowie das heute russische Wyborg, als auch die heftig umkämpften Teile Kareliens mit Wyborg sowie des Ladogasees wanderten während des Großen Nordischen Kriegs 1700-1721 wieder in russische Besitzung.
In der zweiten Hälfte des 18. Jhdts. kam es zu einer Friedensperiode, die sowohl mit wirtschaftlicher als auch kulturelle Entwicklung einherging und Wyborg zu einem wichtigen Knotenpunkt für Handel und kulturellen Austausch machte.
Die ehemals unter schwedischer Herrschaft gestandene Bevölkerung durfte ihren bisherigen lutherischen Glauben beibehalten, jedoch geriet der finnischen Teil durch die Landvergabe des Zaren in Leibeigenschaft.
1808-09 annektierte Russland das gesamte Finnland und erklärte es anschließend zu einem autonomen Großfürstentum. 1812 wurde Altfinnland wieder an Finnland angeschlossen, woraufhin der im Friedensvertrag von Stolbowo ausgehandelten Grenzverlauf erneut in Kraft trat.
Wyborg wurde erneut zum Zentrum Westkareliens und nach der Fertigstellung des Saimaa-Kanals sowie der neuen Eisenbahnroute, die von Lahti bis nach St. Petersburg führte, zusätzlich zu einer wichtigen finnischen Hafenstadt.
Durch die Unabhängigkeitserklärung Finnlands und die Errichtung Sowjet-Russlands wurden Finnisch-Karelien und Russisch-Karlien abermals sowohl politisch als auch ideologisch klar von einander getrennt.
Als Resultat einiger zwischen 1917 und 1922 abgehaltener Volksversammlungen rief das nunmehr russische Karelien seine Unabhängigkeit aus, in der Folge gingen einige karelische Kommunen einen föderativen Bund mit Finnland ein, während andere sich sogar zu einem Teil Finnlands erklärten.
Die folgende Auseinandersetzung zwischen den von finnischer Seite unterstützten Kareliern und den Bolschewiken resultierte 1920 im Friedensabkommen von Tartu, in welchem der bereits in den Verhandlungen von Stolbowo festgelegte Grenzverlauf zwischen Finnland und Sowiet-Russland wiederhergestellt wurde.
Sowjet-Russland versprach ebenfalls, Ostkarelien Autonomiestatus zuzusprechen, diese Bedingung wurde jedoch nicht erfüllt, sodass sich Finnland 1923 an die UN richtete.
Im Juni 1920 wurde die ,Karelische Gruppe des Arbeitenden Volks‘ gegründet, in Folge dem östliche Teil Kareliens unter seinem neuen Namen Autonome Föderative Sowjetrepublik Karelien endlich autonomer Status zugesprochen.
Bald darauf erreichte eine Welle finnischer, kommunistischer Immigranten das Land, von ihnen wurden bald vielen hohe Posten im Staatsapparat zugesprochen.
Durch erfolgreiche Propagandaprogramme reimmigrierten viele nach Amerika ausgewanderte Finnen, um sich dann in ihrer ,Idealheimat‘, der neuen Sowjetrepublik Karelien niederzulassen, viele dieser Idealisten starben später in den Arbeitslagern.
Im Friedensabkommen von Moskau, das dem 1939-40 geführten finnisch-russischen Winterkrieg folgte, wurden die alten,unter Peter dem Großen im Zarenreich geltenden Grenzverläufe wieder in Kraft gesetzt, wodurch Finnland die karelische Region inklusive Wyborg mit Anschluss an den Ladogasee, den Ostteil von Salla sowie die in der Barentsee gelegene Fischerhalbinsel an Russland abtreten musste.
Als Resultat evakuierte Finnland die gesamte Bevölkerung Kareliens, die zur damaligen Zeit etwa 400.000 Menschen umfasste und siedelte sie auf finnischem Gebiet, vor Allem im Osten des Landes, neu an.
Das verlassene Gebiet der jetzt nurmehr ,Föderativen Republik Karelien‘, die 1940-56 ohne Autonomiestatus existierte, wurde bald von Familien aus verschiedensten Teilen der restlichen Sowjetunion bevölkert.
Im Krieg zwischen 1941-44 besetzten finnische Truppen die zuvor verlorenen Territorien und dehnten die finnischen Gebietsansprüche über Russisch-Karelien bis an den ladogasee aus. Die mittlerweile ansässige, nicht karelische Bevölkerung wurde aus den karelischen Gebieten, in denen durch das finnische Militär Regierung und Verwaltungswesen eingerichtet wurden, ausgesiedelt.
Obwohl die finnischen Truppen zu der Zeit unter massivem, deutschen Druck standen, führten sie weder gegen Leningrad noch die Eisenbahnroute, welche die Stadt mit Murmansk verbindet, Angriffe. Der sowjetische Gegenfeldzug von 1944 stellte die alten Grenzen von 1940 wieder her, durch die kontinuierlichen Auseinandersetzungen lag nach dem 2. Weltkrieg nahezu ganz Karelien in Schutt und Asche.
Quellen:
-Nanovfsky, György et al.: The Finno-Ugric World, Teleki László Foundation. Budapest 2004. s.61ff.
-http://www.eldia-project.org/index.php?option=com_content&view=article&id=88%3Akarelian&catid=50%3Alanguage-descriptions-category&Itemid=64&lang=de
-Vorlesungsfolien Prof. J.Laakso Universität Wien, SS2011;
Geographische Verbreitung
Der historische Lebensraum der Karelier liegt im Nordwesten Russlands, wo ein Teil der Ethnie in einem Subjekt der Russischen Föderation, der Autonomen Republik Karelien, lebt. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung von 716.000 Personen liegt heute allerdings nur bei rund 9,2 Prozent. Durch Evakuierungsaktionen und Gebietsabtretungen Finnands während und nach dem finnisch-russischen Winterkrieg (1939- 40) verlor nahezu die gesamte ehemalige karelische Bevölkerung ihre Heimat und wurde in Finnland, hauptsächlich in der Region um Kuopio, jedoch allgemein in ganz Finnland wiederangesiedelt.
Die in Finnland lebenden karelischstämmigen Finnen haben ihre Wurzeln vor allem in Viena-Karelien, in der Region Ilomantsi sowie im finnischen Grenz-Karelien der Nachkriegszeit, das seit den Abtretungen durch die Pariser Friedensverträge von 1947 wieder zu Russland zählt und die Gebiete Salmi, Suistamo, Suojärvi sowie auch Teile von Suomussalmi umfasst.
1989 lebten laut russischen Volkszählungen etwa 131.000 Karelier in Russland, jedoch nur circa 60 Prozent von ihnen in ihrem historischen Siedlungsgebiet, das etwa der heutigen Republik Karelien entspricht. 23.000 Volksangehörige wohnen im Gebiet Tver, während weitere 12.000 in der Region um St. Petersburg und Murmansk beheimatet und einige Gruppen bis nach Sibirien emigriert sind.
Im heutigen Finnland, in dem die Karelier traditionell eine Bevölkerungsminderheit darstellen, leben etwa 40.000 bis 50.000 Volksangehörige.
Quellen:
--Nanovfsky, György et al.: The Finno-Ugric World, Teleki László Foundation. Budapest 2004. s.61ff.
-URL (2011) http://www.eldia-project.org/index.php?option=com_content&view=article&id=88%3Akarelian&catid=50%3Alanguage-descriptions-category&Itemid=64&lang=de
-URL (2011) http://wwwg.uni-klu.ac.at/eeo/Karelisch.pdf
Anmerkung! Karten nur ein erster Versuch. Ich finde, dass alle Karten gleicher Art sein sollen und da es, zumindest für die ostseefinnischen Völker, keine tollen, brauchbaren zu finden gibt, habe ich mich mal selbst daran gemacht. Müssen auf jeden Fall noch verbessert und verfeinert werden! -Verena

Kultur
Quellen:
-Nanovfsky, György et al.: The Finno-Ugric World, Teleki László Foundation. Budapest 2004. s.61ff.
Religion
Text
Folklore

URL (2011) http://www.google.com/imgres?q=carelian+national+costume&um=1&hl=de&client=safari&rls=en&biw=1024&bih=683&tbm=isch&tbnid=hQNp7O1VsJ-wJM:&imgrefurl=http://enjoyrussian.com/news/9681.html&docid=XQrbx_vqP-FDxM&imgurl=http://enjoyrussian.com/resources/9858-original.jpeg&w=640&h=396&ei=Qw3WTryVHozssgabvfWuBg&zoom=1&iact=hc&vpx=602&vpy=187&dur=400&hovh=176&hovw=286&tx=166&ty=95&sig=107523591037888350126&page=1&tbnh=129&tbnw=209&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:13,s:0

URL (2011) http://en.wikipedia.org/wiki/File:National_costume_from_J ääski_in_Karelia_1900.jpg
ääski_in_Karelia_1900.jpg
Kunst
Text
Literatur
Das früheste karelische Sprachdenkmal ist eine Birkenschrift aus dem 13. Jhdt., die 1957 in Nowgorod entdeckt wurde. Der Text ist mit kyrillischen Buchstaben geschrieben und enthält eine heidnische Zauberformel gegen Blitzeinschläge.
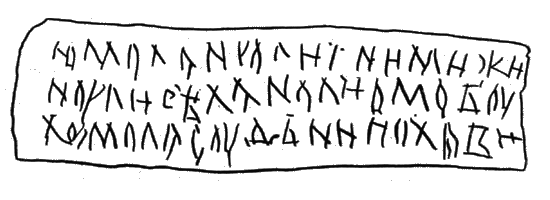
URL (2011) http://heninen.net/petroglif/english.htm
Sprache
Die karelische Sprache lässt sich in drei bis fünf Hauptgruppen aufspalten. Neben dem 'eigentlichen Karelisch', das eng mit dem Weißmeerkarelischen (auch Viena) und dem Südkarelischen (einschl. des Tver-Dialekts) verwandt ist, gehören auch das Olonetzische sowie das Lüdische, das sich von den übrigen Dialekten des Zweigs so entfernt hat, dass es teilweise als eigene Sprache gesehen wird, zu diesem Zweig der Ostseefinnischen Sprachen, dessen Randdialekte gegenseitig nicht verständlich sind.
Neben dem oben beschriebenen Dialektkontinuum zählt nordwestlich von Moskau auch eine Sprachinsel nahe der Stadt Tver zur karelischen Dialektgruppe.
Im Verlauf des 20. Jhdt. wurden die Karelier durch Russifizierungsmaßnahmen in ihrer eigenen Heimat mehr und mehr zur Minderheit. Diese Tabelle zeigt den Rückgang der karelischsprachigen Bevölkerung in der Karelischen Republik in Prozent:
Jahr |
Bev.anteil in % |
1897 |
42,3 |
1926 |
38,2 |
1939 |
23,2 |
1959 |
13,1 |
1979 |
11,1 |
1989 |
10,0 |
Gerade die jüngere Generation beherrscht heute kaum noch die Muttersprache ihrer Vorfahren, generell sehen noch etwa 50% der Karelier einen der karelischen Dialekte als ihre Mutterpsrache an. Umfragen zufolge sprechen ewa 90% der Kinder unter 10 Jahren heute Russisch als erste Muttersprache.
Auch in Tver-Karelien, wo die Anzahl karelischsprachiger Personen einst sogar jene der Republik überragte, ist heute nurmehr etwa ein Fünftel und vor Allem die ältere Generation karelischsprachig.
In Finnland wird das traditionell im Ostteil des Landes verbreitete Karelische erst 2009 als Minderheitensprache anerkannt.
Sprachprobe: http://video.helsinki.fi/Media-arkisto/vainolan_lapset.html
Quelle:
-URL (2011) http://www.eldia-project.org/index.php?option=com_content&view=article&id=88%3Akarelian&catid=50%3Alanguage-descriptions-category&Itemid=64&lang=de