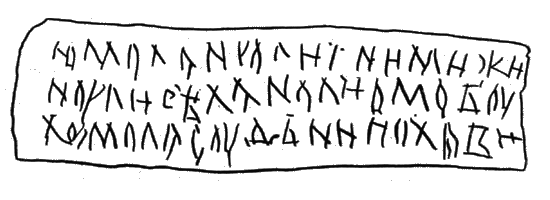...
Quellen:
-Nanovfsky, György et al.: The Finno-Ugric World, Teleki László Foundation. Budapest 2004. s.61ff.
Religion
Text
Folklore
-Gewand:
Die traditionelle Tracht der karelischen Frauen hielt sich, vergleichsweise zu jener der Männer, relativ lang.
Der zur Tracht gehörende, alltäglich getragene Rock (von den Republikskareliern ,sarafaani‘ bzw. ,krassikka‘ von den Ingermanland- und Tverkareliern genannt) weist in seinem Schnitt typisch russische Merkmale auf. Der hohe Bund lag knapp unter der Brust, von dort wurde der Rock mit zwei um die Schulter gelegten, im Rücken gebundenen Gurten über der Bluse oder dem Oberhemd fixiert. Typisch ist auch die stilisierte, gesäumte Knopfleiste auf der Vorderseite des Rocks.
Die Bluse der Oberbekleidung aller karelischen Trachtentypen wurde auf der von der Trägerin aus linken Seite mit einer Spange geschlossen, was ein typisches Charakteristikum russischer und orientalischer Trachtenkultur ist und ist auf der Vorderseite mit einem bestickten, quadratischen Ziertuch (,rekko‘) geschmückt.
Unter den Ingrisch-Kareliern war auch eine bestickte, kurze Bluse oder Oberhemd verbreitet, die am Rücken geknöpft wurde und über abnehmbare Ärmel verfügte.
Eine vereinfachte Variante dieser Bluse war unter dem Namen ,piälizhiemat‘ auch bei den nördlichen Olonetzen verbreitet.
Sommers und bei besonders warmem Wetter auch in den Übergangsjahreszeiten wurden früher auch nur einfache, gegürtete Oberhemden (,rätsinä‘) getragen.
Alte Bestandteil der traditionellen Tracht, die vermutlich bereits in prähistorischer Zeit verbreitet gewesen sein dürften, sind der karelische ,Schulterrock‘ (,hartiushame‘) sowie der um Archangelsk verbreitete ,kosto‘, ein ärmelloser Rock mit breiten Schulterbändern und ursprünglich geschlitzten Seiten. Der ,kosto‘ wurde üblicherweise über zwei bis drei Kleiderschichten sowie mit einer Schürze (,peretn‘ikkä‘) getragen.
Die in Ingermanland lebenden, karelischen Frauen trugen ein um die Hüfte gewickeltes Stück Stoff (,hurstuthame‘). Der von den Enden gelassene Spalt wurde mit einem weiteren, bis unter die Achseln reichenden Tuch (,aannua‘) verdeckt, welches mit einem niedrigen Schulterriemen fixiert wurde.
Die losen Kleider wurden mit einem gewobenen, wollenen Gürtel zusammengehalten, der eine Frau ihr Leben lang begleitete.
Später wurde die karelische Tracht durch breite, bunte Seidenschals vervollständigt, welche durch die Ausgestaltung ihrer Ränder Stand und Wohlstand ihrer Trägerin verrieten. Oft wurden bis zu drei dieser Tücher gleichzeitig getragen.
-Haar und Kopfbedeckungen:
In der karelischen Kultur war das Kopftuch und mit ihm die Tradition des Haarschneidens weit verbreitet, um so länger das Tuch, desto kürzer war das Haar. Obwohl der russische Bischof Makarij 1535 den Frauen verbat, ihr haar zu schneiden, wurde die Tradition bis zum Aufgabe der Volkskultur von den Kareliern und auch den Ingriern weitergeführt.
Verheiratete Frauen trugen ihr Haar immer in Tücher gebunden, eine Fertigkeit, die oft von professionierten Frauen vermittelt wurde. Die Art, wie das meist weiße Kopftuch gebunden werden durfte unterlag dem sozialen Stand der Frau, ebenso ihrem Wohlstand und der Tradition ihres Kulturkreises.
Mit der Zeit entwickelten sich Variationen in der Tragweise des Kopftuchs. Die estnischen Ingrier, Ostkarelier und Republik-Karelier begannen, das teilweise verzierte, weiße Leinentuch einfach an mit einer Seite um den Kopf zu binden, während die dritte Ecke des Tuchs am Hinterkopf hinunter hing. Später wurde dieser herabhängende Teil auf unterschiedlichste Weise unter die um den Kopf befestigte Seite gebunden.
Aus dieser Kopfbedeckung entwickelte sich schließlich eine einfach geschnittene Haube (,sorokka‘), die auf der Stirn ein besticktes Viereck zeigt und bei der die dritte Ecke des
Tuchs unter dem Haaransatz im Nacken in die beiden verknoteten eingeschlagen wird.
In Ostkarelien trugen die Frauen nach russischem Vorbild unter dem ,sorokka‘ ein ,samsuri‘, ein Kissen, das die Haube auf der Stirn hoch halten sollte.
Später wurde in Ostkarelien das ,säpsä‘ populär, eine aus roter Seide gefertigte Kappe mit sehr kleiner KrempeQuelle: alle Bilder Toivo Vuorela: The Finno-ugric peoples. Indiana University Bloomington, 1964. s.107 (Skizze), s. 127 (Kleid), s.108 (Muster).
Kunst
Text
Literatur
Das früheste karelische Sprachdenkmal, welches gleichzeitig generell den zweitältesten Beleg einer finno-ugrischen Sprache darstellt, ist eine Birkenschrift aus dem 13. Jhdt., die 1957 in Nowgorod entdeckt wurde. Der Text ist mit kyrillischen Buchstaben geschrieben und enthält eine heidnische Zauberformel gegen Blitzeinschläge.
URL (2011) http://heninen.net/petroglif/english.htm![]()
...